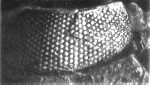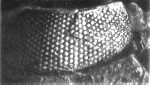
Trilobitenauge
aus Katalog:
Sehen und Sein, '94
|
|
Ausstellung
SEHEN UND SEIN
Experimente in eigener Sache
Prof.Dr. Wolfgang Tunner
9.Oktober 1994 - 13.November 1994
Schloß Wolkersdorf Vortragssaal - 1. Stock, Schloßplatz 2, A - 2120 Wolkersdorf
Am Tag der Eröffnung fanden Vorträge und Gespräche zum gleichen Thema statt.Ausstellung und Gespräche
Mit der Ausstellung "SEHEN UND SEIN", die als Grundsatzüberlegung und Thema auch fotografische Praxis und Theorie betrifft,
findet die von der Nö. Fotoinitiative FLUSS veranstaltete Reihe "lese" ihre Fortsetzung.
Unter dem Titel "SEHEN UND SEIN" zeigte Prof. Tunner eine Ausstellung mit Ergebnissen seiner Experimente zur Psychologie der
Wahrnehmung. Diese wissenschaftlichen Arbeiten wurden in einen bildhaften Erfahrungszusammenhang mit alltäglichen
Lebensweisen, philosophischen Erkenntnissen und ästhetischen Einstellungen gebracht. Außerdem zeigten Heinz Cibulka und Hermann
Nitsch künstlerische Arbeiten, die in einem direkten Bezug zur Person von Tunner entstanden sind.
Vortragende und Gesprächteilnehmer:
Univ. Prof.Dr. Herbert Bauer, Wien, Neuropsychologie
Univ.Prof.Dr. Hans Belting, Karlsruhe, Kunstwissenschaft
Univ.Doz.Dr.med.phil. Lydia Hartl, München, Medizin und Psychologie
Rudolf Leitner-Gründberg, Bubendorf, Malerei
Prof. Hermann Nitsch, Frankfurt/ Main und Prinzendorf, Aktionismus und Malerei
Univ.Prof.DR. Lutz von Rosenstiel, München, Wirtschaftspsychologie
Fritz Scheuer, München, Malerei
Univ.Prof.Dr. Wolgang Tunner, Krahof/NÖ und München, Klinische Psychologie
Univ.Prof.Dr. Peter Vitouch, Wien, Medienpsychologie
SEHEN UND SEIN
Konzept der Ausstellung
Wolfgang Tunner
Die Ausstellung kam durch Initiative von Heinz Cibulka zustande. Er machte mir den Vorschlag, Bilder und Texte zu Wissenschaft,
Kunst und dem alltäglichen Leben zu zeigen, die mir für mein eigenes Verständnis der Dinge wichtig sind. Wie in den Aufsätzen, die
ich zur Psychologie und Kunst veröffentlichte, sollte es durch Bild und Sprache zu einer Huldigung der Sinneswelt kommen. Der
Zusammenhang von Bild, Idee und Begriff sollte die Einsicht bekräftigen, wie sehr Sprache die konkrete Erfahrung benötigt, um
Ausdruck zu gewinnen. Denn Begriffe sind schwach, die nicht im Sinnlichen gründen. Soll diese Erkenntnis in einer Ausstellung
mitgeteilt werden, besteht die Gefahr, sich in der Absicht zu widersprechen: Im Vergleich zur tatsächlichen Erfahrung sind Bild und
Wort an der Wand abstrakt. Von den wirklichen Beweggründen der Sprache sind sie zu weit entfernt, um der Idee der Ausstellung zu
entsprechen. Bilder sind mehr anschauliche Analogie von Begriffen als eine ihrer bildenden Wurzeln. Zwar geben bekanntlich Bilder für
die Phantasie vielfältige Anreize, aber sie wirken nicht so sehr auf die Sprache wie auf die Entstehung weiterer Bilder. Das gilt nicht nur
für die Kunst, sondern auch für die Wissenschaft, wo Bilder den Gang der Spekulation nicht unbedingt fördern. Außerdem sind die
Inhalte wissenschaftlicher Bilder mit bloßem Auge normalerweise nicht sichtbar. Sie sind Bilder des Unsichtbaren. Niemand kann
Zellverbände, Moleküle, Elementarteilchen oder Feuersbrünste der Gestirne mit freiem Blick sehen. Erst das apparativ gerüstete Auge
macht sie wahrnehmbar und läßt sie als Bilder erscheinen. Es besteht daher die Frage, ob das technisch bewaffnete Sehorgan das
Leben in der Welt unmittelbarer Erscheinungen nicht viel eher stört, als seine Intensität zu steigern. Was bringt es, angesichts einer
Körperbewegung Bilder der Nervenzellen vor Augen zu habe, die bei dieser Bewegung in Erregung geraten. Es kann sein, daß alle diese
indirekt wahrnehmbaren Bilder vom Leben - so wie es mit dem freien Auge erscheint - ablenken.
Vor dem Hintergrund der technisch manipulierten und zu künstlichen Szenarien zusammengestellten Scheinwelten unseres modernen
Alltags wirken solche Bedenken allerdings zeitwidrig. Aber trotzdem oder gerade deshalb sind sie von Aktualität.
Denn je mehr Einblick
in die Manipulierbarkeit der Wahrnehmung besteht und je größer die Kenntnisse über die Ordnung und das Durcheinander in den
Feinstrukturen unseres Gehirns sind, um so stärker wird das Bedürfnis, in einen ganz gewöhnlichen und von der Sonne gereiften Apfel
zu beißen. Die bildende und stets zeitgemäße Kraft solcher Bedürfnisse sollte man nicht unterschätzen. - Aber wie dem auch sei, auf
was es mir dabei hier ankommt, ist die Mannigfaltigkeit der visuellen Erscheinungen. Auf sie möchte ich hinweisen und sie als solche
begreifen. Nicht auf Erklärungen bin ich aus, sondern auf die Gegenwart der Erscheinungen selbst. Es kommt mir dabei - trotz vieler
Bedenken - auch nicht darauf an, ob sie mit freiem Auge oder mit technischen oder künstlerischen Methoden sichtbar werden. Einzig
die Antwort auf die Frage entscheidet, ob wir einen Weg finden, auf dem die Vielfalt der sichtbaren Welt als ein Ganzes begriffen
werden kann. Ein solcher Weg hätte zweifellos große Wirkung auf Leben und Sprache.
Zur Gliederung der Ausstellung habe ich die Bilder und Gegenstände auf Vorgänge bezogen, die man als Experimente bezeichnen kann
und die unter ästhetischen Gesichtspunkten geordnet, Einstellungen philosophischer Art erkennen lassen. In diesem Sinne ist die
Ausstellung eine Gelegenheit, auf gemeinsame Bereiche von Wissenschaft, Kunst und Philosophie hinzuweisen.
Zur Ausstellung erschien ein 70-seitiger bebilderter Katalog mit Texten folgender Autoren:
Wolfgang Tunner: Konzept der Ausstellung "Sehen und Sein"
Heinz Cibulka: Wolfgang Tunner
Lydia Andrea Hartl: Von der Einheit in der Vielfalt
Hermann Nitsch: Aktion für Wolfgang Tunner
Hans Belting: Das natürliche Wunder
Lutz von Rosenstiel: Wolfgang in der grauen Wüste
Niels Birbaumer: Neurophysiologie von Lernvorgängen
Florian Sundheimer: Wie die Tannennadeln zum Ameisenhaufen kommen
Katalog: lese '94: Wolfgang Tunner "SEHEN UND SEIN"
|